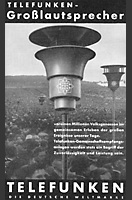Anfang 1924 berichtet Eugen Nesper, Herausgeber der Zeitschrift Der Radio-Amateur, von einer amerikanischen Erfindung in Art eines elektromechanischen ‚Körperschall-Lautsprechers‘, der es Schwerhörigen und Gehörlosen ermöglichen soll, beispielsweise Telephongespräche und Rundfunksendungen zu rezipieren:
„Das Osophon von H. Gernsback“
„Vor kurzem hat H. Gernsback in New York, der bekannte Chefredakteur der amerikanischen Zeitschriften ‚Radio News‘ und ‚Science and Invention‘, deren monatliche Auflagen weit in die Hunderttausende gehen, einen neuen Empfangsapparat erfunden, welcher geeignet erscheint, auch Schwerhörigen, ja sogar tauben Personen Schallschwingungen bemerkbar zu machen. Dieser Apparat, »Osophon« genannt, wird nicht zur Einwirkung auf das Ohr, sondern vielmehr zur Übertragung der von fern zugeleiteten Schallenergie auf die Zähne benutzt. Die Wirkung auf eine taube Person ist offenbar ähnlich derjenigen, welche ausgelöst wird, wenn eine entsprechend ihrer Taubheit empfindliche Person mit den Fingerspitzen eine schwingende Membrane berührt. Abb. 1 zeigt die Anordnung. An einem Handgriff a ist ein Elektromagnetsystem b befestigt, dessen Pole in eine entsprechend unterteilte Eisenplatte c auslaufen. Auf dieser sind zwei Hartgummipole daufgesetzt, welche die aus der Abbildung ersichtliche Gestaltung aufweisen. An den Einschnürungsstellen wird der Apparat in den Mund gesteckt, derart, daß die Zähne mit den Hartgummipolen Kontakt machen.
Die Erregung dieses Osophons findet in gewöhnlicher Weise statt, in der Abbildung dadurch, daß ein Mikrophon mit der Batterie in den Kreis der Elektromagnete eingeschaltet ist.
Die beste Wirkung wird erzielt, wenn nicht allzu fest mit den Zähnen zugebissen wird, sondern wenn dieselben mit den Hartgummipolen einen bestimmten Kontakt herstellen, da alsdann die Schwingungsenergie am vorteilhaftesten auf die Zähne und damit auf das Nervensystem des Kopfes übertragen werden sollen. Der Widerstand des Osophons beträgt 5½ Ohm, die Batterie soll bei dieser Schaltung eine Spannung von 6 Volt haben. […]
Nach Mitteilungen von Herrn Gernsback soll das Osophon genau so verwendbar sein wie ein gewöhnliches Telephon, also für einen Radio-Empfänger, für Drahttelephonie, für einen Phonographen, für einen Taschenfernsprecher (Diktaphon) usw.
Abb. 2 zeigt den Erfinder H. Gernsback, während er mit seinem Radio-Empfangsapparat Konzert empfängt und die Schallübertragung durch das Osophon auf sich einwirken läßt.
Es ist zu wünschen, daß diese neue Erfindung auch in Deutschland Erfolg und Eingang findet.“ [Nesper in: Radio-Amateur 1 1924, 10f.]
„Das Hören mit den Zähnen. Bemerkungen zum Osophon Gernsbacks“
„Durch die europäische Radiopresse gehen jetzt Berichte über eine von Gernsback in die Praxis eingeführte Vorrichtung, die es gestatten soll, Schwerhörigen, ja selbst Ertaubten Schalleindrücke zu vermitteln. So berichtet auch der ‚Radio-Amateur‘ im ersten Heft, Seite 10 dieses Jahrganges, über das Osophon des bekannten amerikanischen Publizisten.
Da ich mich mit Grenzfragen der Medizin und Elektrizitätswissenschaft beschäftige und auch schon vor einiger Zeit Versuche gemacht habe, die in Richtung der Gernsbackschen Gedankengänge liegen, möchte ich in aller Kürze zu der Erfindung Gernsbacks Stellung nehmen. Zuvor einige Bemerkungen zur Physiologie des Gehörs.
Eine Gehörsempfindung kann nur dann zustande kommen, wenn das Nervenempfangsorgan, nämlich die Spiralwindung des Gehörnerven, erregt wird. Wie für das Auge die Lichtwelle, bildet für das Ohr die Schallwelle den spezifischen Sinnesreiz. Für gewöhnlich erfolgt die Erregung des Gehörnerven durch Vermittlung der Luft. Der Kehlkopf als Sender für Tonschwingungen ist durch die Luft elastisch mit dem Ohr des Hörers gekoppelt. Nun kann das Endorgan des Hörnerven auch direkt, d. h. durch Übertragung der Schwingungen auf den knöchernen Schädel in Erregung versetzt werden.
Für das Hören selbst ist unter normalen Bedingungen die Knochenleitung ohne Bedeutung. Hingegen spielt sie bei der Prüfung der Hörschärfe eine Rolle. Wir unterscheiden nämlich zwei Arten von Schwerhörigkeit: eine auf Verminderung der Schalleitung beruhende und eine weitere, die im Gehörnerven selbst ihren Sitz hat. Das bekannteste Beispiel einer Hörstörung der ersten Art ist der Mittelohrkatarrh und die Mittelohreiterung. Die nervöse Schwerhörigkeit äußert sich vielfach in subjektiven Gehörgeräuschen, Sausen und Summen, ist ärztlicher Einwirkung schwer zugänglich und führt in einer Anzahl von Fällen zur völligen Ertaubung. Als ein typisches Beispiel nervöser Schwerhörigkeit möchte ich das Gehörleiden Beethovens anführen.
Welcher Art die Hörstörung ist, kann in vielen Fällen durch eine einfache Stimmgabelprüfung, den Rinneschen Versuch, erkannt werden. Beim Gesunden überwiegt die Luftleitung in allen Fällen die Knochenleitung. Mit anderen Worten, eine vor das Ohr gehaltene angeschlagene Stimmgabel wird dann noch gehört, wenn sie auf die Umgebung des Ohres gesetzt, keine Hörempfindung mehr auslöst. Es ist verständlich, daß bei Erkrankungen des Schalleitungsweges, so bei Mittelohrentzündung, der Rinnesche Versuch negativ ausfällt, das heißt, die Stimmgabel vom Knochen besser gehört wird als durch die Luft. Das Gegenteil ist bei nervöser Schwerhörigkeit der Fall. Hier ist die Gehörsempfindung vom Knochen aus gegenüber der Luftleitung vermindert.
Hieraus ergibt sich, daß für die an nervöser Schwerhörigkeit Leidenden – es ist dies eine große Zahl der Schwerhörigen überhaupt – eine Vermittlung der Schalleindrücke durch den Knochen nicht in Frage kommen kann. Wie steht es nun mit der Idee Gernsbacks, die auf den ersten Blick etwas Bestechendes hat und konstruktiv solide und gut durchgebildet ist. Daß die Zähne als freiliegende Teile des Knochenskeletts für die Übermittlung von Schalleindrücken geeignet sind, ist eine physiologisch bekannte Tatsache. Man kann nicht einmal sagen, daß sie neu ist, weiß doch bereits Cardanus im Jahre 1560 von ihr zu berichten.
[…] Immerhin sind a priori die Voraussetzungen gegeben, bei Schwerhörigen, deren Hörstörung auf verminderter Schalleitung beruht, durch Ausnutzung der erhaltenen Knochenleitung die Hörfähigkeit zu verbessern. Doch wird man selbst mit den erwähnten Einschränkungen seine Erwartungen nicht allzu hoch spannen dürfen. Es zeigt sich nämlich, daß in vielen Fällen von länger bestehender Schwerhörigkeit, auch wenn sie zunächst ihren Sitz im Mittelohr hat, doch der Hörnerv nicht allzu selten in Mitleidenschaft gezogen wird. So engt sich der Kreis der Anwärter, denen das Gernsbacksche Modell nützlich sein soll, weiter ein. Ganz allgemein läßt sich sagen, daß man bei Berichten über Hörverbesserung durch Apparate eine gesunde Skepsis walten lassen muß, indem fast immer die Erfolge weit hinter den Erwartungen zurückbleiben.
In dieser Hinsicht kann ich den Optimismus von E. Nesper nicht teilen. Ich möchte vielmehr annehmen, daß in der Schwerhörigkeitsbekämpfung das Osophon, von Spezialfällen abgesehen, ebensowenig eine Rolle spielen wird als die Apparatur eines amerikanischen Ingenieurs Hanson, der neuerdings die Schwerhörigkeit mit den Methoden der Radiotelephone bekämpfen will(1). […]“
(1) Jacobsohn, Drahtlose Telegraphie und Schwerhörigkeit. Klinische Wochenschrift Nr. 4. 1924.